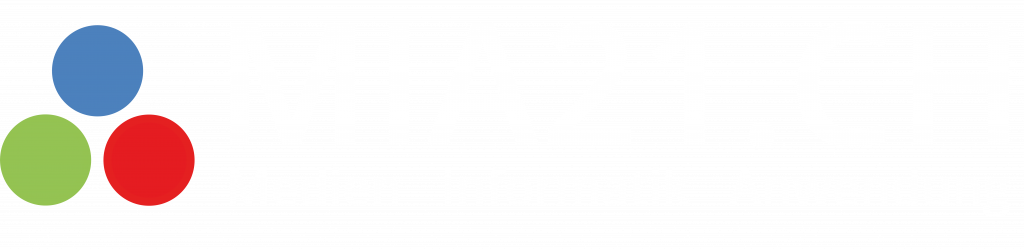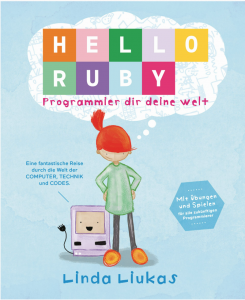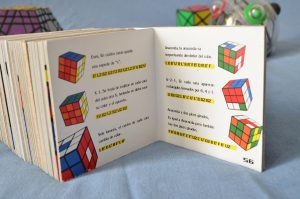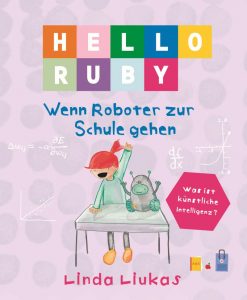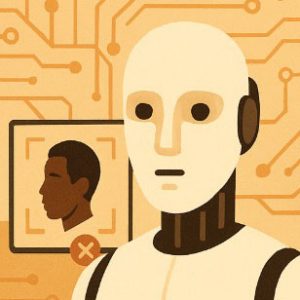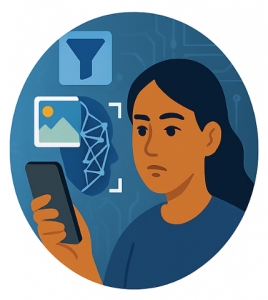Ob zur Unterrichtsvorbereitung, bei Rechercheaufgaben oder zur schnellen Klärung von Fakten bei Uneinigkeiten – Wikipedia hat sich als fester Bestandteil in unserem digitalen Informationsalltag etabliert. Diese allgegenwärtige Verfügbarkeit lässt bisweilen die Idee dahinter vergessen: ein globales Projekt der kollektiven Wissensproduktion, getragen vom Engagement Millionen Freiwilliger. Bis heute behauptet sich Wikipedia als einzige nicht-kommerzielle und werbefreie Plattform in der Kategorie der meistbesuchten Webseiten weltweit.
Ihre Relevanz potenziert sich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wo sie nicht nur als zentrale Trainingsgrundlage für KI-Sprachmodelle dient, sondern auch im didaktischen Kontext neue Möglichkeiten eröffnet, etwa durch KI-gestützte Zusammenfassungen von Artikeln.
Trotz dieser rasanten technologischen Entwicklung bleibt Wikipedia seit ihrer Gründung 2001 vier zentralen, unveränderlichen Grundsätzen verpflichtet:
- dem enzyklopädischen Anspruch,
- dem Gebot der Neutralität resp. des neutralen Standpunktes,
- der freien Lizenzierung aller Inhalte (Creative-Commons-Lizenz) und
- dem respektvollen Umgang miteinander (keine persönlichen Angriffe).
Nicht zu vergessen: Als eine der wenigen grossen Plattformen entzieht sich Wikipedia der Logik personalisierter Algorithmen und bietet allen Menschen weltweit eine identische Wissensbasis.
Die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen wirft zentrale Fragen für den Bildungskontext auf:
- Welche technologischen Architekturen und sozialen Prozesse ermöglichen es, dass eine derart offene Plattform ihre Qualität sichern kann?
- Welche soziokulturellen Dynamiken prägen die Gemeinschaft der Freiwilligen?
- Welche didaktischen Ansätze befähigen unsere Lernenden, Wikipedia nicht nur als Informationsquelle zu nutzen, sondern sie als komplexes Mediensystem kritisch zu reflektieren und kompetent mitzugestalten?
Perspektiven im Überblick

Sie beleuchtet das Zusammenspiel der Software MediaWiki mit der zentralen Datenbank Wikidata, das die Konsistenz und Funktionalität der über 300 Sprachversionen sichert.

Gesellschaftlich-
kulturelle Perspektive
Sie untersucht die sozialen Prozesse, Relevanzkriterien und Aushandlungskonflikte innerhalb der Freiwilligen-Community.

Anwendungs-
bezogene Perspektive
Sie zeigt auf, wie eine kompetente Nutzung über das reine Lesen hinausgeht und wie man die Qualität von Artikeln beurteilen und selbst beitragen kann.
WarmUp
Wikipedia ist ständig in Bewegung. Um ein Gefühl für diese Dynamik zu bekommen, probieren Sie eine der folgenden Aktivitäten aus:
Mit dem Smartphone oder Tablet:
Besuchen Sie die Webseite listen.hatnote.com. Sie hören und sehen in Echtzeit, wie rund um den Globus Artikel bearbeitet werden. Jeder Ton steht für eine Veränderung: Hinzugefügte Inhalte klingen wie Glocken, gelöschte wie ein Cello – je grösser die Änderung, desto tiefer der Ton. Lauschen Sie für einen Moment dem «Klang des Wissens». (Hinweis: Diese Seite funktioniert am besten auf mobilen Geräten und ist auf Notebooks nicht immer verfügbar.)
Mit dem Notebook:
Besuchen Sie die deutschsprachige Wikipedia und klicken Sie im Menü links oben mehrmals auf «Zufälliger Artikel». Welche Themen entdecken Sie? Achten Sie auf die enorme Bandbreite – von wissenschaftlichen Nischenthemen über Popkultur bis hin zu lokalen Ereignissen.
Technologische
Perspektive
Ein häufiges Missverständnis ist, dass es nur die eine Wikipedia gibt. Tatsächlich existieren über 300 verschiedene Sprachversionen, die als eigenständige und verteilte Projekte funktionieren. Der deutschsprachige Artikel über den Mond beispielsweise ist keine automatische Übersetzung des englischen, sondern ein eigenständiges Werk, das von der deutschsprachigen Community nach eigenen Regeln verfasst wird. Aber wie schaffen es diese vielen Enzyklopädien bei zentralen Fakten konsistent zu bleiben?
Die technologische Antwort liegt in einem Zwei-Säulen-System:
- MediaWiki – Das «Betriebssystem» für jede einzelne Wikipedia: Man kann sich die Software MediaWiki wie das «Betriebssystem» für jede Sprachversion vorstellen. Sie stellt die Werkzeuge zur Verfügung, um die einzigartigen Artikel zu schreiben und zu diskutieren. Das wichtigste Werkzeug ist die Versionsgeschichte, die jede Änderung transparent speichert und es erlaubt, unerwünschte Bearbeitungen einfach rückgängig zu machen.
- Wikidata – Der zentrale «Aktenschrank» für alle: Parallel dazu existiert Wikidata, eine riesige, mehrsprachige Datenbank. Sie ist der gemeinsame «Aktenschrank» für strukturierte Daten. Hier wird zum Beispiel die Bevölkerungszahl der Schweiz nur einmal zentral für alle über 300 Sprachversionen gespeichert.
Das Zusammenspiel ist einfach, aber wirkungsvoll: Während der Fliesstext über die Schweiz in der deutschsprachigen Wikipedia einzigartig ist, holt sich die Infobox die Bevölkerungszahl direkt aus der Datenbank von Wikidata. Wird diese Zahl in Wikidata aktualisiert, ändert sie sich automatisch in der deutschen, englischen, französischen und allen anderen Sprachversionen gleichzeitig.
Gesteuert wird dieses Zusammenspiel von einem hybriden Kontrollsystem aus erfahrenen Community-Mitgliedern (sog. Sichter*inner) und automatisierten Programmen (Bots), die gemeinsam die Qualität und Stabilität sichern.
Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive
Wikipedia ist eine kollaborative Plattform. Der Aussage, dass jede*r einfach so einen Wikipedia-Artikel erstellen kann, ist technisch zwar korrekt, unterliegt in der Praxis jedoch wichtigen sozialen Kontrollmechanismen. Ob ein neuer Beitrag bestehen bleibt, entscheidet die Community. Diese prüft jeden neuen Artikel auf Basis formaler und inhaltlicher Regeln. Eine der wichtigsten Hürden ist dabei die Relevanz. Die Gemeinschaft legt anhand detaillierter Kriterien fest, ob ein Thema als enzyklopädisch bedeutsam gilt. Damit soll verhindert werden, dass Wikipedia zu einem Sammelsurium von Belanglosigkeiten wird. Diese Relevanzhürde fungiert als eine Art redaktionelles Korrektiv, das von der Community selbst ausgeübt wird. Die Dimensionen dieses Korrektivs sind beachtlich: So stehen in der deutschsprachigen Wikipedia über 3 Millionen Seiten einer aktiven Autorenschaft von nur etwas über 18’000 Personen gegenüber.
Die offene Natur von Wikipedia nährt den weitverbreiteten Glauben, die Plattform sei anfällig für Falschmeldungen und Desinformation (Fake News). Tatsächlich gibt es bekannte Fälle von Hoaxes – bewusst erstellte Falschinformationen –, die teils jahrelang unentdeckt blieben und das Misstrauen gegenüber der Plattform bestärken. Demgegenüber steht jedoch ein robustes Kontrollsystem: Die Community prüft unermüdlich Änderungen, automatisierte Bots erkennen Vandalismus und die strikte Belegpflicht fordert überprüfbare Quellen. Obwohl einzelne Hoaxes existieren, sind sie im Verhältnis zu Millionen von Artikeln extrem selten. Das Phänomen der Hoaxes zeigt somit eindrücklich die Spannung zwischen Offenheit und dem gemeinschaftlichen Streben nach Verlässlichkeit. Bedenkt man die verhältnismässig kleine Anzahl potenzieller Autor*innen, so ist diese Zuverlässigkeit umso mehr als bemerkenswerte Leistung zu bewerten.
Die soziale Struktur dieser Gemeinschaft, die über Relevanz und Qualität entscheidet, muss sich aber auch kritischen Aspekten stellen. Studien zeigen, dass die Gemeinschaft mehrheitlich aus Männern des globalen Nordens besteht. Dies führt zu einer zentralen gesellschaftlichen Frage: Wessen Wissen und welche Perspektiven werden repräsentiert – und welche nicht? Dieser sogenannte Bias (Verzerrung) zeigt sich etwa darin, dass es deutlich mehr Artikel über Männer als über Frauen gibt oder dass Themen aus westlichen Kulturen oft ausführlicher behandelt werden. Die Dachorganisation Wikimedia bemüht sich seit Jahren aktiv darum, mehr Frauen als Autorinnen zu gewinnen – aktuell wird davon ausgegangen, dass weniger als 20 % der Beitragenden weiblich ist.
Die Inhalte selbst entstehen in einem ständigen sozialen Aushandlungsprozess. Auf den Diskussionsseiten der Artikel wird oft intensiv um Formulierungen gerungen – bis manchmal hin zu kontraproduktiven Edit-Wars, wo dann rigorose Regelmechanismen ins Spiel kommen. Grundlage dafür sind die Kernprinzipien wie der neutrale Standpunkt und die Belegpflicht.
Doch was als «neutral» gilt, ist selbst eine kulturelle Frage und muss immer wieder neu verhandelt werden. Wikipedia ist somit nicht nur ein Abbild unseres Wissens, sondern auch ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Konflikte und Debatten über Wahrheit und Deutungshoheit.
Die rechtliche und kulturelle Grundlage für dieses globale Gemeinschaftsprojekt bilden die Creative-Commons-Lizenzen. Sie ersetzen das traditionelle Urheberrecht («Alle Rechte vorbehalten») durch ein Modell des Teilens. Inhalte dürfen frei kopiert, weiterverbreitet und bearbeitet werden, solange die Urheberschaft genannt wird. Dieses Lizenzmodell ist das Fundament, das die Vision von freiem Wissen erst ermöglicht und die globale Bewegung zusammenhält. Es gilt nicht nur für die Texte, sondern auch für die zentrale Mediendatenbank Wikimedia Commons, aus der ein Grossteil der Bilder und Videos stammt.
Anwendungsbezogene Perspektive
Eine kompetente Nutzung von Wikipedia geht über das blosse Lesen des Artikeltextes hinaus und erfordert im Unterricht eine Auseinandersetzung mit der Funktionsweise der Plattform. Erst der Einbezug ihrer spezifischen Werkzeuge wie der «Versionsgeschichte» oder der «Diskussionsseite» macht die sozialen Aushandlungsprozesse sichtbar und fördert die Entwicklung einer fundierten Medienkompetenz (Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung).
Zusätzlich zu diesen analytischen Schritten gibt die Community selbst visuelle Hinweise auf die Qualität eines Artikels. Grosse, oft rote Warn-Bausteine am Anfang eines Textes weisen auf gravierende Mängel wie fehlende Belege oder umstrittene Neutralität hin. Im Gegensatz dazu signalisieren andere Piktogramme wie Sternchen oder Buchstabensymbole am oberen rechten Rand eines Artikels eine besonders hohe, von der Community geprüfte Qualität, wie beispielsweise bei «lesenswerten» oder «exzellenten» Artikeln.
Weitere Indizien für die Beurteilung können die Anzahl der Autor*innen, die Häufigkeit der Besuche, die Dichte der internen Verweise sowie die Qualität des Quellenverzeichnisses sein.
Natürlich kann Wikipedia auch als reines Nachschlagewerk genutzt werden. Ein souveräner Umgang beginnt jedoch dort, wo das blosse «Copy&Paste» aufhört und eine kritische Auseinandersetzung mit den Werkzeugen der Plattform stattfindet.
Die höchste Stufe ist die eigene Beteiligung. Dies muss nicht das Verfassen eines neuen Artikels sein; oft verbessern kleine Schritte wie das Korrigieren eines Tippfehlers oder das Ergänzen einer Quelle die Qualität. Sich als Autorin und Autor zu etablieren, ist anspruchsvoll, doch moderne Werkzeuge wie der WYSIWYG-Editor erleichtern den Einstieg. Für erste Versuche bietet die «Spielwiese» einen geschützten Raum. Schwesternprojekte wie der Reiseführer Wikivoyage eignen sich zudem gut für den Einsatz in der Schule und ermöglichen den Schritt vom Konsum zur Mitgestaltung. Weitere niederschwellige Projekte im Geiste von Wikipedia wie Klexikon und Mini-Klexikon sind bereits für die Primarstufe geeignet.
Gesamtblick
Wikipedia ist ein komplexes soziotechnisches System, in dem Technologie und soziale Prozesse untrennbar miteinander verwoben sind: Die Software schafft den Rahmen für die Zusammenarbeit und das Speichern der Informationen, doch erst die Gemeinschaft füllt ihn mit Inhalten, Regeln und Debatten. Sie ist offen für alle, wird aber von einer relativ kleinen, freiwilligen Gemeinschaft getragen. Die seit Jahren stagnierende oder gar rückläufige Zahl aktiver Mitwirkender stellt eine der grössten Herausforderungen für die Zukunft dieses faszinierenden digitalen Kulturguts dar.
Bei aller berechtigten Kritik an ihren Schwächen ist Wikipedia ein in seiner Art einzigartiges, weltumspannendes Projekt. In einer digitalen Welt, die zunehmend von kommerziellen Interessen und personalisierten Algorithmen geprägt ist, stellt sie ein Gegenmodell dar. Wikipedia ist nicht perfekt, aber sie verkörpert den unermüdlichen Versuch, sich durch transparente Prozesse und gemeinschaftliche Aushandlung so etwas wie einer objektiven Wahrheit anzunähern. Allein dieser Umstand macht eine Auseinandersetzung mit Wikipedia als Phänomen im Unterricht mehr als lohnenswert!
BY Konsortium MIA21
Dieser Beitrag ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY 4.0).
Praxis und Unterricht
Bildungsrobotik
Bildungsrobotik bezeichnet den Einsatz von Robotern und programmierbaren Geräten, zum Beispiel Mikrocontrollern im Bildungswesen, um Schüler*innen informatische Konzepte sowie allgemeine …
Software
Software ist ein Programm (eine Serie von Anweisungen), das einem Computer sagt, wie er funktionieren soll. Bei Computerprogrammen werden zwei …
Hello Ruby – Programmier dir deine Welt
Thema: Computational Thinking (Grundkonzepte des Programmierens)
Herausgeber: Bananenblau
Stufe: Zyklus 1
Das Buch von Linda Liukas führt auf spielerische und …
Informatik Biber:
Ausgewählte Graph Biber Karten
Thema: Algorithmen, Graphen
Herausgeber: Informatik Biber Schweiz
Stufe: Zyklus 2
Die Informatik Biber Materialien stehen jeweils thematisch zur Verfügung und …
Algorithmen
Algorithmen sind präzise und schrittweise formulierte Anleitungen zur Lösung von Problemen. In der Informatik werden Algorithmen in Programmen genutzt, um …
Bilderbuch zu Künstlicher Intelligenz
Thema: Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
Herausgeber: Bananenblau
Stufe: Zyklus 1
Das Buch von Linda Liukas führt Kinder in das …
Weiterführende Phänomene und Konzepte
Over-Tourism durch soziale Medien
Soziale Medien verwandeln versteckte Geheimtipps in überlaufene Hotspots. Virale Posts bekannter Influencer*innen können dazu führen, dass nicht nur bekannte Tourismusorte …
Algorithmischer und racial Bias
Bias, zu Deutsch Verzerrung oder Vorurteil. Wenn ein Algorithmus oder eine KI verzerrt arbeitet, bedeutet das: Er behandelt bestimmte Gruppen …
TikTok – Mehr als nur Tanz und Trends
Auf TikTok wird getanzt, gesprochen, gelacht – und manchmal auch diskutiert. Die App ist für viele Jugendliche längst mehr als …
Maschinengenerierte Schönheitsideale
Digitale Medien können ein Mittel zur Selbstinszenierung sein. Filter, Selfies, Avatare und Profilbilder beeinflussen, wie Kinder und Jugendliche sich selbst …
Digital Health
Wearables, also tragbare Technologien wie Fitness-Tracker oder Smartwatches, erlauben es uns, unsere Gesundheit, Fitness oder unseren Schlaf kontinuierlich zu überwachen …
Software
Software ist ein Programm (eine Serie von Anweisungen), das einem Computer sagt, wie er funktionieren soll. Bei Computerprogrammen werden zwei …