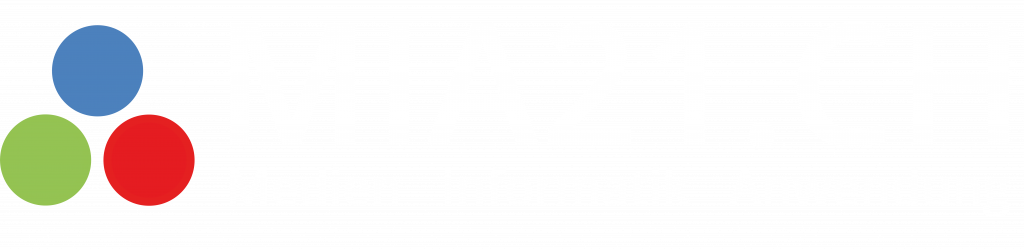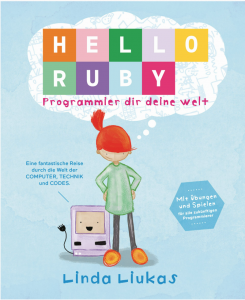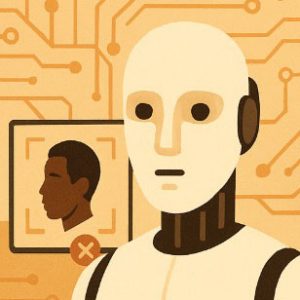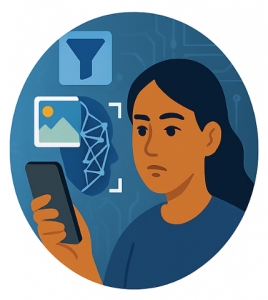Auf TikTok wird getanzt, gesprochen, gelacht – und manchmal auch diskutiert. Die App ist für viele Jugendliche längst mehr als Unterhaltung: Sie ist Teil ihres Alltags, ein Ausdrucksmittel und eine Informationsquelle zugleich.
Doch was macht TikTok so erfolgreich – und wie beeinflusst es, wie wir denken, handeln und miteinander kommunizieren? Dieser Pincho wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie TikTok als spannender Lernanlass im Unterricht genutzt werden kann.
Perspektiven im Überblick

Diese Perspektive beleuchtet, wie TikTok technisch funktioniert und welche algorithmischen Strukturen die Auswahl und Sichtbarkeit von Inhalten steuern.

Gesellschaftlich-
kulturelle Perspektive
Hier geht es darum zu verstehen, wie TikTok gesellschaftliche Trends, Werte und Identitäten prägt und welche Chancen und Risiken daraus entstehen.

Anwendungs-
bezogene Perspektive
Diese Perspektive zeigt auf, wie TikTok praktisch im Unterricht eingesetzt werden kann, um Mediengestaltung, Reflexion und Verantwortung zu fördern.
WarmUp
Zeit für einen Selbstversuch!
Öffne TikTok (oder recherchiere online nach einem aktuellen Trend) und nimm dir fünf Minuten für eine Beobachtung:
- Welches Video siehst du zuerst?
- Was hörst und siehst du?
- Was macht dieses Video für dich spannend oder vielleicht auch irritierend?
- Welche Rückschlüsse ziehst du daraus für dich selbst oder deine Schülerinnen und Schüler?
Technologische
Perspektive
TikTok ist nicht einfach ein klassisches soziales Netzwerk, sondern ist ein algorithmisches System, das Inhalte gezielt empfiehlt und verbreitet. Es setzt dabei weniger auf Freundeslisten, sondern vor allem auf Inhalte («Content-first»). Das ermöglicht auch Nutzer:innen ohne viele Follower, schnell Reichweite zu gewinnen.

Quelle: Generiert mit ChatGPT
Dafür nutzt TikTok mehrere technische Säulen:
- Hybrides Empfehlungssystem: Kombiniert Verhaltensmuster (z. B. was ähnliche Nutzer:innen mögen) und Inhaltsmerkmale (z. B. Themen, Sounds, Hashtags), um passgenaue Vorschläge zu machen.
- Echtzeit-Analyse: Nicht nur Likes zählen, sondern auch Verweildauer oder Wiederholungen.
- Tiefgehende Inhaltsanalyse (Multimodalität): Hier geht TikTok einen entscheidenden Schritt weiter. Der Algorithmus analysiert nicht nur einfache Schlagwörter, sondern versteht den Inhalt auf mehreren Ebenen. Mittels automatischer Sprach- und Bilderkennung erfasst er den Kontext eines Videos: Er erkennt gesprochene Worte, die Stimmung der Musik oder abgebildete Objekte. So kann ein Video über einen Golden Retriever auch Nutzern vorgeschlagen werden, die sich allgemein für «Haustiere» oder «Familienleben» interessieren, selbst wenn diese Begriffe nicht explizit vorkommen.
Neue Videos werden zunächst an eine kleine Testgruppe ausgespielt. Wenn diese positiv reagiert (vor allem über Shares), verbreitet sich der Inhalt immer weiter.
All das passiert hochautomatisiert und kann dazu führen, dass Jugendliche in immer ähnliche Inhalte abgleiten. Das birgt Risiken: Filterblasen, einseitige Sichtweisen oder sogar extreme Inhalte können sich verstärken. Dieses Hineinziehen in thematische Nischen (sogenannte «Rabbit Holes») kann problematische Einstellungen fördern. Auch die Taktik, Nutzende möglichst lange am Bildschirm zu halten, kann dazu führen, dass sie sehr viel Zeit auf der Plattform verbringen und es ihnen schwerfällt, damit aufzuhören – was zu einem suchtähnlichen Verhalten führen kann.
Obwohl Zeitlimits eingeführt wurden, um die Nutzungsdauer zu begrenzen, lässt sich die genaue Funktionsweise des Algorithmus für Aussenstehende nicht nachvollziehen. Diese Intransparenz ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um seine Funktionsweise und Auswirkungen mit Schülerinnen und Schülern kritisch zu beleuchten.
Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive
TikTok beeinflusst, wie Jugendliche sich zeigen, wie sie wahrgenommen werden und wie sie sich selbst einschätzen. Sichtbarkeit entsteht weniger durch das eigene soziale Umfeld, sondern über Trends und den Erfolg bei einem anonymen Publikum. Wer den «richtigen» Sound oder einen aktuellen Trend bedient, kann schnell Aufmerksamkeit bekommen.
Diese Mechanismen wirken auf das Selbstwertgefühl:
- Was bin ich wert, wenn mein Video keine Likes bekommt?
- Wie gehe ich mit beleidigenden Kommentaren um?
- Was passiert, wenn andere meine Inhalte ohne Erlaubnis weiternutzen?

Quelle: Generiert mit ChatGPT
Solche Fragen beschäftigen Jugendliche und sollten im Unterricht aufgegriffen werden.
Gleichzeitig entstehen auf TikTok beeindruckende Subkulturen. Bestes Beispiel: #BookTok, das ganze Bestsellerlisten beeinflusst. Ähnliche Bewegungen gibt es in Wissenschaft, Politik oder Bildung.
Doch TikTok ist auch umstritten:
- Die Creator Economy bringt Chancen, aber auch Stress und finanzielle Unsicherheit.
- Die chinesische Eigentümerschaft wirft Fragen zum Datenschutz und zur politischen Einflussnahme auf.
- Schnelle, emotionsgeladene Inhalte können das Risiko für problematisches Nutzungsverhalten erhöhen, besonders bei Jugendlichen, die bereits belastet sind.
All das macht TikTok zu einem Ort voller Chancen – aber auch Risiken, über die Schule sprechen sollte.
Anwendungsbezogene Perspektive
TikTok bietet weit mehr als nur Konsum. Es kann zu einem lebendigen Lernfeld werden, in dem Jugendliche eigene Videos entwickeln, Ideen umsetzen und deren Wirkung reflektieren.
Ein möglicher Ansatz hierfür ist ein iteratives Videoprojekt, bei dem ein Thema in mehreren kleinen Schritten erarbeitet wird. Die Videos können dabei im TikTok-Stil auch auf einer geschützten Plattform erstellt und geteilt werden, um kreative Potenziale ohne Datenschutzrisiken zu nutzen.
Im Rahmen dieses Projekts lernen die Schüler:innen, wie Creator den Algorithmus gezielt beeinflussen, indem sie starke «Hooks» (packende Einstiege), «Call-to-Actions» (Aufforderungen zur Interaktion), Trend-Sounds und eine aufmerksamkeitsstarke Bildsprache einsetzen.

Quelle: Generiert mit ChatGPT
Ein Beispiel ist die Methode DigitalSchoolStory:
- Video 1 – Ausprobieren: Erste Ideen kreativ umsetzen
- Video 2 – Überarbeiten: Rückmeldungen nutzen
- Video 3 – Verfeinern: Qualität steigern und Haltung zeigen
Dabei steht nicht nur die Technik im Vordergrund, sondern auch Teamarbeit, das Geben und Nehmen von Feedback sowie kritisches Denken. Auch die Analyse politischer Inhalte oder ein Blick auf den eigenen «Für dich»-Feed können Teil des Projekts sein. So lassen sich Aspekte der demokratischen Medienbildung vertiefen, über Themen wie Hate Speech und Desinformation aufklären und gleichzeitig beobachten, wie der Algorithmus auf gezielte Interaktionen reagiert.
Leitfragen unterstützen den Prozess:
- Wer soll das Video sehen?
- Welchen Effekt haben Musik oder Bildsprache?
- Wie verändert Feedback den Blick auf das Thema?
So entstehen Lernprodukte, bei denen Haltung, Kreativität und digitale Verantwortung zusammenspielen.
Gesamtblick
Als spannender Lernanlass im Unterricht bietet TikTok – eine Plattform, die algorithmisch gesteuerte Empfehlungssysteme mit kultureller Dynamik (durch Trends und Subkulturen) verbindet – sowohl Chancen für Ausdruck und Teilhabe als auch Risiken wie Filterblasen, Suchtpotenzial und Datenschutzfragen.
Indem Jugendliche dort aktiv mitgestalten, anstatt nur zu konsumieren, wird TikTok zu einem Lernfeld für kritische Medienkompetenz und digitale Verantwortung.
- Wie verändert sich der Blick Jugendlicher, wenn sie selbst aktiv werden?
- Wie kann Schule diesen Raum so begleiten, dass Reflexion, Gestaltung und Verantwortung möglich werden?
Praxis und Unterricht
Dagstuhl-Dreieck
Wir leben in einer digital geprägten Gesellschaft, in der Kultur der Digitalität (Stalder), was Veränderungen in der Lebens- und Arbeitswelt …
Hello Ruby – Programmier dir deine Welt
Thema: Computational Thinking (Grundkonzepte des Programmierens)
Herausgeber: Bananenblau
Stufe: Zyklus 1
Das Buch von Linda Liukas führt auf spielerische und …
Informatik Biber:
Ausgewählte Graph Biber Karten
Thema: Algorithmen, Graphen
Herausgeber: Informatik Biber Schweiz
Stufe: Zyklus 2
Die Informatik Biber Materialien stehen jeweils thematisch zur Verfügung und …
Weiterführende Phänomene und Konzepte
Over-Tourism durch soziale Medien
Soziale Medien verwandeln versteckte Geheimtipps in überlaufene Hotspots. Virale Posts bekannter Influencer*innen können dazu führen, dass nicht nur bekannte Tourismusorte …
Algorithmischer und racial Bias
Bias, zu Deutsch Verzerrung oder Vorurteil. Wenn ein Algorithmus oder eine KI verzerrt arbeitet, bedeutet das: Er behandelt bestimmte Gruppen …
Wikipedia – Anatomie eines fragilen Phänomens
Ob zur Unterrichtsvorbereitung, bei Rechercheaufgaben oder zur schnellen Klärung von Fakten bei Uneinigkeiten – Wikipedia hat sich als fester Bestandteil …
Maschinengenerierte Schönheitsideale
Digitale Medien können ein Mittel zur Selbstinszenierung sein. Filter, Selfies, Avatare und Profilbilder beeinflussen, wie Kinder und Jugendliche sich selbst …
Digital Health
Wearables, also tragbare Technologien wie Fitness-Tracker oder Smartwatches, erlauben es uns, unsere Gesundheit, Fitness oder unseren Schlaf kontinuierlich zu überwachen …
Online-Bewerbungen
Online-Bewerbungen bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu traditionellen Bewerbungsverfahren auf Papier. Bewerbungen sind von überall aus möglich, die …